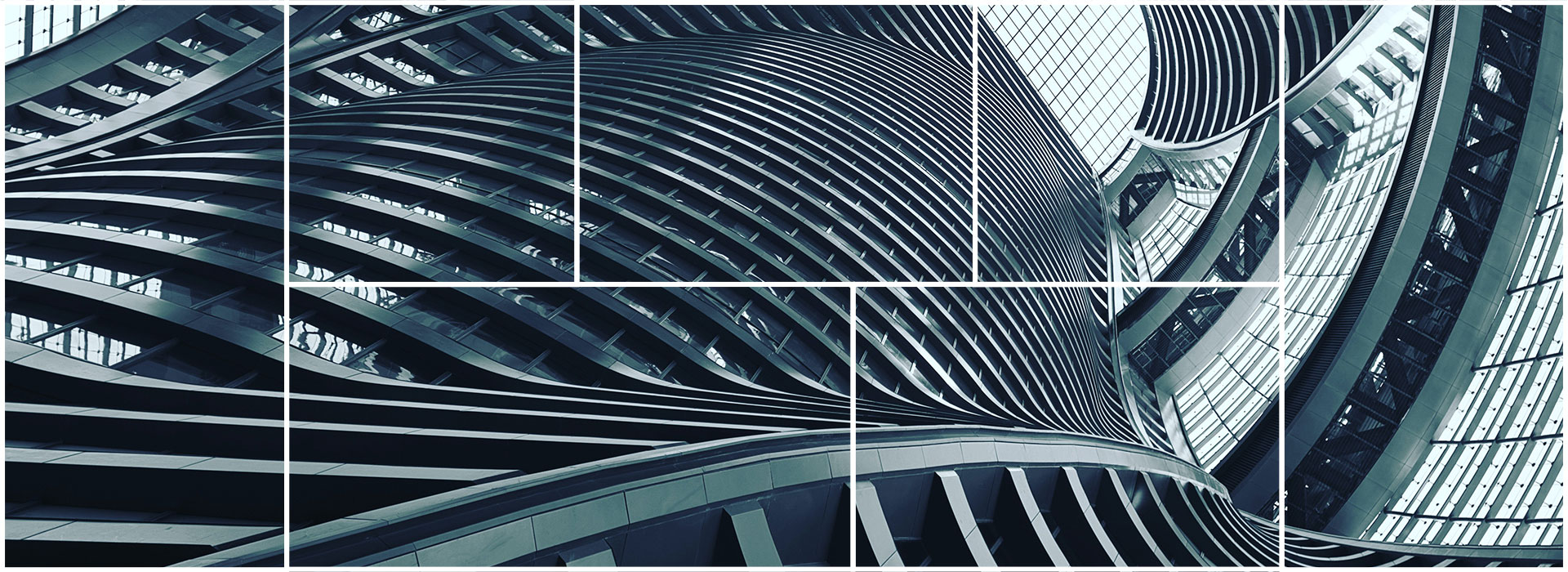
Diffuse Vielfalt der Sanktionsordnungen
Autor: Marcel Alexander Niggli, publiziert in NZZ, 29. Februar 2024
Im Umgang mit Sanktionen gegen Russland besteht Unbestimmtheit. Eine Bank kann Transaktionen verweigern, auch wenn diese in der Schweiz zulässig wären. Gastkommentar von Marcel Alexander Niggli.
Die Schweiz hat 2003 das «Gesetz über die Durchsetzung von internationalen Sanktionen», kurz: Embargogesetz, erlassen. Das Gesetz ist seither mit nur marginalen Änderungen in Kraft und bestimmt, dass der Bund Zwangsmassnahmen erlassen kann, um Sanktionen durchzusetzen, die von der Uno, der OSZE «oder von den wichtigsten Handelspartnern der Schweiz beschlossen worden sind». Für den Erlass der Massnahmen ist der Bundesrat zuständig. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat die EU zwölf gegen Russland gerichtete Sanktionspakete erlassen, welche die Schweiz grossmehrheitlich übernommen hat. Dazu wurde im März 2022 die Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine, die ab 2014 bestand, ersetzt. Und diese neue Verordnung wurde seit März 2022 fünfzig Mal geändert und an die Vorgaben der EU angepasst.
Höchst unbestimmter Zustand
Die rechtsstaatlichen Probleme sollen hier nicht thematisiert werden. Betroffene können auch itrechtsstaatlich Heiklem umgehen, solange es nur klar ist. Tatsächlich aber enden die Schwierigkeiten nicht damit, dass vor einer möglichen Transaktion proaktiv abgeklärt werden muss, ob die betroffenen Personen gegenwärtig auf einer Sanktionsliste genannt werden, oder damit, dass das Seco angefragt wird. Selbst wenn das Seco als zuständige Stelle eine Transaktion nämlich als rechtskonform erklärt, ist damit nicht viel gewonnen. Und genau das stellt das Problem dar. Eventuell nämlich wird eine Bank die Ausführung der Transaktion trotzdem verweigern, zum Beispiel unter Verweis auf Sanktionen anderer Staaten und ihre vermeintliche Geltung in der Schweiz sowie bankinterne Compliance-Vorschriften. Der gegenwärtige Zustand ist höchst unbestimmt.
Wie kommt es, dass, obwohl die zuständige staatliche Stelle eine Transaktion als rechtskonform einstuft, sie in ihrer Umsetzung trotzdem Probleme bereitet? Wie kann es sein, dass alle Beteiligten versuchen, ihr Bestes zu tun, und dennoch Beliebigkeit resultiert? Das dürfte an der Auslagerung staatlicher Kontrollaufgaben an Private liegen, wie sie im Finanzmarkt etwa bei der Geldwäscherei üblich geworden ist. So werden nämlich Zielsetzungen vermengt, die nicht harmonieren. Geld liebt Klarheit. Lieber harte, aber klare Regeln als grosszügige und schwammige Vorgaben. Der Staat legt – mehr oder weniger glücklich – seine Vorgaben fest. Eine Bank orientiert sich aber nicht an politischen Vorgaben, sondern an ihrem eigenen Interesse, namentlich an Reputationsrisiken.
Zu beobachten ist nun leider eine Tendenz zur «overcompliance», das heisst, es wird versucht, alle nur möglichen Regeln einzuhalten, also nicht nur die schweizerischen, sondern auch diejenigen anderer Länder. Das wird damit begründet, dass ausländische Sanktionsregime extraterritoriale Geltung hätten, also auch hier gültig seien. Vorgebracht wird auch, global tätige Finanzinstitute verfolgten einen Einheitsstandard, an dem sich alle Ländereinheiten orientierten. Das aber verletzt unter Umständen die Schweizer Souveränitätundbegründetdamit gerade die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Bank. Bei den Sanktionen gegen Russland etwa ergeben sich notwendig Kollisionen zwischen den Interessen der Finanzinstitute und denjenigen ihrer Kunden. Denn neben jener der Schweiz, der EU und der USA existieren allein in der EU neun weitere nationale Sanktionsordnungen, hinzu kommen diejenige Grossbritanniens und zehn aussereuropäische (z. B.Australien, Kanada und Japan). Es bestehen also mindestens zwanzig Sanktionsordnungen, die voneinander teilweise erheblich abweichen. Was also gilt?
Strafrechtlich heikel
Gemeint sind nicht Situationen, in welchen ein Schweizer Institut auch einer ausländischen Rechtsordnung untersteht. In solchen Fällen ist klar, dass auch diese Rechtsordnung zu respektieren ist. Was aber gilt, wenn keine ausländische Rechtsordnung anwendbarist? Sind trotzdem alle Sanktionsordnungen einzuhalten oder nur einzelne? Oder nur diejenigen, die gerade in die eigenen Risikoüberlegungen passen? Soll die Bank selbst entscheiden, welche Sanktionsordnung sie respektieren will? Der einfachste Weg aus dem Dilemma wäre, wenn die Politik nach demVorbild von Grossbritannien ein «blocking statute» erliesse, das heisst ein Verbot, ausländischen Sanktionsordnungen extraterritoriale Wirkung zu gewähren. Damit wäre Klarheit geschaffen. Dies wird in absehbarer Zeit kaum geschehen, womit nur der unangenehme Weg über das Strafrecht bliebe. Dann müsste man die Banken daran erinnern, dass die Verweigerung von Transaktionen nicht nur Nötigung im Sinne von Art. 181 Strafgesetzbuch darstellen kann, sondern auch – und schwerwiegender – eine verbotene Handlung für einen fremden Staat (Art. 271 StGB). Die freiwillige Einhaltung ausländischer Sanktionsordnungen konfligiert notwendig mit der Schweizer Souveränität. Denn welche Funktion könnte unsere Sanktionsordnung haben, wenn die ausländischen ohnehin gelten beziehungsweise sich Schweizer Akteure ihnen einfach unterwerfen? Eine Anwendung ausländischer Sanktionsordnungen erscheint daher strafrechtlich heikel und birgt jedenfalls Risiken.